„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ ist nicht nur der neue Film des renommierten Regisseurs Mohammad Rasoulof, sondern auch der diesjährige deutsche Oscar-Beitrag. In seinem dramatischen Thriller erzählt, der aus seinem Heimatland geflohene, Rasouluf anhand der fiktiven Geschichte einer Familie über die anhaltenden Unruhen im Iran und dem Kampf um Freiheit sowie blinder Hörigkeit gegenüber der Obrigkeit. Ob „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ wirklich Chancen auf einen Erfolg bei der Oscar-Verleihung besitzt und warum dieser Film so unendlich wichtig ist, erfahrt ihr in der folgenden Filmkritik.
Ein Beitrag von: Florian
Worum geht es in „Die Saat des heiligen Feigenbaums“?
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (Originaltitel: دانهی انجیر معابد, international bekannt als The Seed of the Sacred Fig) ist ein Spielfilm von Mohammad Rasoulof aus dem Jahr 2024. Das Drama erzählt die Geschichte eines iranischen Ermittlungsrichters, der während der landesweiten politischen Proteste gegen das autoritäre Regime zunehmend von Misstrauen und Paranoia gegenüber seiner eigenen Familie geplagt wird. Die Hauptrollen spielen Missagh Zareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami und Setareh Maleki. Der Film verwebt fiktive Szenen mit realen Aufnahmen der blutig unterdrückten Proteste durch die iranischen Behörden.
Iman (Iman Misagh Zareh) wird zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran befördert, als das Land von einer massiven Protestbewegung erschüttert wird. Der Tod einer jungen Frau wird zum Auslöser der Demonstrationen, die immer intensiver werden und auf zunehmend harte Gegenmaßnahmen des Regimes stoßen. Iman stellt sich auf die Seite des Staates, was nicht nur seine eigene psychische Belastung verstärkt, sondern auch die Harmonie in seiner Familie gefährdet.
Während seine Töchter Rezvan (Mahsa Rostami) und Sana (Setareh Maleki) von den Ereignissen tief bewegt und aufgerüttelt sind, versucht seine Frau Najmeh (Soheila Golestani) verzweifelt, die Familie zusammenzuhalten. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Iman feststellt, dass seine Dienstwaffe verschwunden ist, und er beginnt, Verdacht gegen seine eigene Familie zu hegen.
Über die Schwierigkeiten „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ zu drehen und zu veröffentlichen

Auch interessant: Mickey 17 – Filmkritik
Mohammad Rasoulof ist international mittlerweile ein angesehener Regisseur, dessen Filme ein hohes Aufsehen erregen. Allerdings spricht er sich mit seinen Werken auch immer wieder gegen die Umstände und somit auch das Regime im Iran aus. Immer wieder wurden ihm, von politischer Seite aus, Steine in den Weg gelegt. 2020 wurde ihm die Reiseerlaubnis zur Berlinale nach Berlin verweigert, sodass er den Hauptpreis in Abwesenheit gewann. Mehrfach wurde Rasoulof im Iran inhaftiert und wieder freigelassen. Verschiedenste Delikte, wie etwa Propaganda wurden ihm vorgeworfen.
In einem Interview gibt Rasoulof an, seine Inhaftierung im Jahre 2022 wäre ausschlaggebend für die Entwicklung von „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ gewesen. Zur gleichen Zeit begannen die Jina-Proteste im Iran. Frauen gingen auf die Straßen, demonstrierten für ihre Rechte. „Frau, Leben, Freiheit“ war ein viel genanntes Motto. Dieser Mut faszinierte Rasoulof. Dann traf er auf einen Gefängnismitarbeiter, der ihm gegenüber Gewissensbisse offenbarte. Die Idee für „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ war geboren.
Gedreht wurde unter strenger Geheimhaltung und in ständiger Angst die Geheimdienste könnten von dem Filmprojekt erfahren. Die Dreharbeiten waren dementsprechend schwierig, das Equipment nicht so, wie es für einen großen Spielfilm eigentlich nötig ist. Es mussten Darsteller gefunden werden, die sich klar gegen das Regime bekennen. Am Ende stand für viele, die zum Teil gescheiterte Flucht aus dem Iran.
Das Erwachsenwerden im Iran
Zu einem großen Teil wird die Geschichte aus der Sicht zweier Töchter erzählt. Rezvan und Sana wurden von ihren Eltern streng religiös erzogen. Was Gott sagt, ist richtig. Die Frau ist nur dafür da irgendwann verheiratet zu werden und Nachkommen zu zeugen. Gegenüber dem Vater wird blinder Gehorsam gefordert. Doch auf den Straßen mehren sich die Demonstranten. Das Internet bringt viele Meinungen mit sich. Aber auch viele Videos, die von der Regierung nicht glaubhaft als Irritation feindlicher Nationen dargestellt werden können.
Und plötzlich ist er da, dieser Gedanke der Freiheit. Vielleicht gibt es da draußen in der Welt mehr, als von den Eltern beigebracht wurde. „Die Saat des heiligen Feigenbaumes“ zeigt, was es bedeutet als junge Frau im Iran aufgewachsen zu sein und nun in ein enges Korsett gezwängt zu werden. Rezvan und Sana jedoch streben beide auf unterschiedliche Art und Weise nach Freiheit. Altersbedingt verstehen sie die Situation anders, doch der Ruf nach Selbstbestimmung lockt sie Beide. Das fangen Mahsa Rostami und Setareh Maleki auch jede auf ihre Weise glaubwürdig ein. Insbesondere Rostami entfaltet eine schauspielerische Wucht, die ihres Gleichen sucht
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ zeigt, wie ein Zuschauer erst zum Mitläufer und schließlich zum paranoiden Mittäter wird
Bücher mit ähnlichen Themen im Thalia Shop. JETZT STÖBERN
Solche jungen Frauen findet Rasoulof beeindruckend. Männer wie der Gefängniswärter, den er in Interviews erwähnte, liefern ihm seine Geschichten. Und so ist „Die Saat des heiligen Feigenbaumes“ nicht nur die Geschichte von aufbegehrenden jungen, kämpferischen jungen Frauen, sondern auch die des Familienvaters Iman. Ein Mann, der immer schon von Wohlstand träumte. Nun wurde er befördert. Der Traum ist in greifbare Nähe gerückt.
Iman ist das wahre Zentrum von „Die Saat des heiligen Feigenbaums“. Anhand dieser Figur versucht Rasoulof die Probleme im Iran zu veranschaulichen und deckt dabei eigentlich Verhaltensweisen auf, welche solche Regime erst möglich machen. Anfangs zweifelt Iman noch. Er kann doch nicht einfach ohne Grund Todesurteile unterschreiben. Die eigene Angst vor dem Regime, der Drang nach einer erfolgreichen Karriere machen ihn zum Mitläufer. Nur nicht auffallen. Einfach machen, was die da oben sagen. Bis das Kartenhaus zusammenzubrechen droht. Aus Angst wird Panik. Aus Panik wird Paranoia. Sah Iman anfangs noch unbeteiligt zu, wurde er erst zum Mitläufer und schließlich zum Mittäter. Dieser Wandel, diese inneren Konflikte stellt Misagh Zare wunderbar heraus.
Ein familiärer Konflikt als Allegorie auf einen ganzen Staat
So fehlt nur noch ein Puzzleteil in der vermeintlich heilen Familie, die sich schlussendlich als gefährliches Pulverfass entpuppt. Eine tickende Zeitbombe. Lange Zeit ist unklar, welche Rolle Soheila Golestani als Mutter Najmeh eigentlich spielt. Najmeh scheint die Familie zusammenzuhalten. Versucht den Zusammenhalt zu wahren. Sie gibt sich hart gegenüber ihren Töchtern, gibt sich dem System gegenüber als treu ergeben. Und doch sind da diese Momente, in denen die Fassade aufbricht, sie mit ihren vermeintlichen Wertvorstellungen bricht. Soheila Gostani legt Najmeh wunderbar undurchschaubar. Erst spät offenbart sie, dass Najmeh in erster Linie Mutter ist.
Im Zusammenspiel erschaffen diese Vier nun das Bild einer komplett zerrissenen Familie. Eine Familie in welcher die Töchter beginnen sich gegen das Entscheidungsmonopol des Vaters aufzulehnen. eine Familie, in der sich die Mutter irgendwann zwischen ihrem Mann und ihren Töchtern entscheiden muss. Eine Familie, in welcher der Vater verzweifelt darum ringt, die Kontrolle zu behalten und dafür bereit ist zu immer drastischeren Mitteln zu greifen. Rasoulof erschuf mit dieser Familie eine Allegorie auf die großen politischen und gesellschaftlichen Konflikte im Iran. Er reduziert sie auf den kleinen Raum von vier Menschen. Dadurch werden sie zugänglicher, aber nicht weniger bedeutsam.
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ wird zum unnachgiebigen Thriller
Dabei räumt Rasoulof in der ersten Stunde auch noch den tatsächlichen Auseinandersetzungen auf der Straße etwas Zeit ein. Erst nachdem das Stimmungsbild komplett, die angespannte Atmosphäre im Iran etabliert ist, zeigt „die Saat des heiligen Feigenbaumes“ sein wahres Gesicht. Noch zwei Stunden verbleiben nun dem Thriller. Eine Geschichte, die mit einer verschollenen Dienstwaffe beginnt und nicht gewaltfrei enden kann.
Es ist beeindruckend, wie „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ mit jeder Sekunde mehr an der Stellschraube der Spannung dreht. Mit jeder Minute, in der die Waffe fehlt, wird Iman unruhiger und paranoider. Seine Angst wird deutlich. Er steht unter Druck, muss zu seinem eigenen Schutz die Waffe finden. Diesen Druck gibt er an seine Familie weiter. Die Folge sind psychologische Folter, eine zu eskalieren drohende Verfolgungsjagd mit Autos und ein nervenzerfetzendes Finale in einer Ruinenstadt.
Rasoulof zieht aus dem puren Grauen eine faszinierende inszenatorische Schönheit

Auch interessant: Der Graf von Monte Christo – Filmkritik
All das ist schockierend, verstörend und mitreißend. Eindrücke, die Rasoulof durch seine Inszenierung noch verstärkt. Und das, obwohl „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ durch das Drehen im Geheimen visuell etwas eingeschränkt ist. Doch Rasoulof macht aus der Not eine Tugend. Die Proteste auf der Straße werden über Videos auf Social Media gezeigt. Echte Videos, die das Geschehen noch greifbarer machen.
Überdies gelingen Rasoulof aber auch aus ganz eigener Kraft Szenen und Bilder, die ich nie wieder vergessen werde. Es ist eines der schönsten Bilder des Films, wenn Schrotkugeln mitsamt Blutstropfen in ein Waschbecken fallen. Zuvor wurde minutenlang gezeigt, wie diese Kugeln aus einem verunstalteten, blutüberströmten Gesicht gepuhlt werden. Es ist kaum mit anzusehen, doch die Kamera bleibt unnachgiebig. Sie hält drauf und beschönigt nichts. Dennoch sind die Bilder auch immer wieder schön. Insbesondere das Finale in den Ruinen ist toll gefilmt. Die Bilder an sich sind wunderschön, solange einem der Kontext verborgen bleibt.
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ ist ein emotional herausforderndes und zu Teilen ein schier überwältigendes Werk
Zum Ende folgt einhergehend mit der vielleicht größten Stärke des Films auch noch eine Warnung. „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ muss man sehen wollen. Die Bereitschaft sich darauf einzulassen ist ebenso wichtig, wie das Wissen was zu erwarten ist. Letzteres besteht in einem emotional überbordenden gar überfordernd wirkenden Werk, welches dem Zuschauer über fast drei Stunden viel abverlangt.
Das trifft vor allem auf die erste Stunde zu. In dieser streift „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ viele Einzelschicksale lediglich, macht sie aber so greifbar, dass das Publikum in Gänze mitfühlen kann. Daraus ergibt sich eine Tragik, die manchmal kaum zu ertragen ist. In den späteren zwei Dritteln weicht diese emotionale Intensität ein wenig. Das ist einerseits mein einziger kleiner Kritikpunkt, allerdings ist die Kritik auf unfassbar hohem Niveau. Durch die Konzentration auf die vier Familienmitglieder fehlt zwar die emotionale Ergriffenheit, wenn die Massen betroffen sind, dennoch gelingen weiter starke Gänsehautmomente, in denen ich von meinen Emotionen übermannt wurde. Nur nicht mehr mit der Schlagzahl, wie noch in der ersten Stunde.
Fazit zu „Die Saat des heiligen Feigenbaums“:
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ ist fantastisch inszeniert, gespielt und geschrieben. Das Gesamtergebnis ist dadurch unfassbar beeindruckend und im ersten Moment kaum greifbar. Auch weil der neue Film von Rasoulof so unglaublich wichtig ist. In der Geschichte finden sich Lehren, die nicht nur auf den Iran, sondern universell anwendbar sind.
Ob der Film nun wirklich eine Chance hat, bei der diesjährigen Oscarverleihung als bester Film ausgezeichnet zu werden, kann ich nicht beurteilen. Das Feld der Konkurrenten ist reich an interessanten und potentiell ebenbürtigen Filmen. Und dennoch hätte „Die Saat des heiligen Feigenbaumes“ mit Sicherheit meine Stimme. Ich wünsche dem Film jeden denkbaren Erfolg. Denn das, was der Film mit mir gemacht hat, geschieht nur sehr selten.
Werdet ihr euch „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ im Kino ansehen?
TRAILER: ©Alamode Filmverleih

Unterstützt uns!
Transparenzhinweis: Affiliate-Programme
Wir möchten dich darüber informieren, dass wir an Affiliate-Programmen teilnehmen. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision erhalten können, wenn du über einen unserer Links Produkte oder Dienstleistungen kaufst. Für dich entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten – der Preis bleibt derselbe.
Durch diese Unterstützung können wir unsere Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen und stetig verbessern. Vielen Dank, dass du uns auf diese Weise hilfst!
Dir gefällt was wir machen? Dann supporte uns! Kommentiere, teile und like unsere Beiträge auch in Social Media. Mit deiner Unterstützung sorgst du dafür, dass die Seite weiter betrieben werden kann.

FLORIAN – Filmkritiker
Meine Leidenschaft begann wohl schon recht früh in meiner Kindheit, als ich erstmals die Karl May Verfilmungen der 60er Jahre von Rialto Film sah. Daraufhin erforschte ich klassische und modernere Filmreihen von Star Wars bis hin zum Marvel Cinematic Universe. Irgendwann wurde aus der Lust nach Abenteuer und Action eine Liebe zum Medium Film, die mich auch abseits der berühmten Blockbuster auf faszinierende Reisen schickte. Seit Juli 2020 bin ich auf Letterboxd aktiv und erweitere seither meinen Horizont beständig. Daraus entwickelte sich seit der Sichtung von „RRR“ und dem Kinobesuch von „Jawan“ eine Liebe für das indische Kino. Offen bin ich abseits dessen für nahezu alle Jahrzehnte und Genres, lediglich amerikanischen Komödien bleiben ich am liebsten fern.
Andere Meinungen zu „Die Saat des heiligen Feigenbaums“:
Peter Gutting von film-rezensionen.de
„Die Saat des heiligen Feigenbaumes“ erzählt von der Familie eines iranischen Ermittlungsrichters, deren liebevolles Miteinander dem Druck des Systems nicht mehr standhält. Regisseur Mohammad Rasoulof lässt jegliche Rücksicht auf die Zensur fahren und inszeniert ein ebenso berührendes wie spannendes Thriller-Drama, das an politischer Wahrhaftigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. 9 von 10 Punkte.
Kathrin Hollmer von Fluter
„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ erzählt von zwei iranischen Schwestern, die in die „Frau, Leben, Freiheit“-Demonstrationen geraten. Der Film wurde heimlich gedreht und geht 2025 für Deutschland ins Oscarrennen.
Carolin Weidner von Perlentaucher – Das Kultmagazin
Die Familie eines Ermittlers am Revolutionsgericht zersetzt sich während der Proteste nach dem Tod Jin Mahsa Aminis selbst. Mohammad Rasoulofs neuer Film „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ entfaltet sich als Drama von nahezu klassischer Qualität und stellt sich der Frage, ob der durchseuchte iranische Staat noch zu retten ist.
Dietmar Kanthak von epd film
Die Familie ist in »Die Saat des heiligen Feigenbaums« ein Spiegel des Systems. Ihr Zerfall und die zunehmende Brutalität im Privaten bilden in Rasoulofs Film das Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung im Iran ab. Sein Film zeigt das ebenso drastisch wie kunstvoll. Und mit einem Ende, das durchaus ein Quäntchen Hoffnung erlaubt. 5 von 5 Sterne.
Pressematerial: Die Saat des heiligen Feigenbaums | 2024 ©Alamode Filmverleih








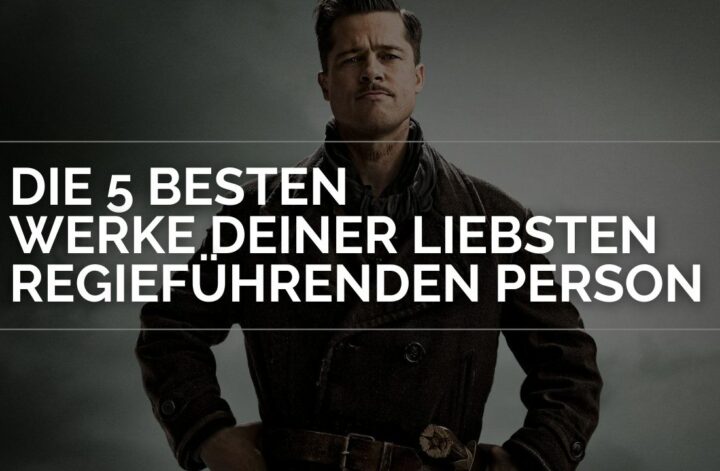

2 Kommentare
Ich habe den Film relativ spät gesehen, nachdem meine Schwester ihn mir empfohlen hat – und ich habe keine Sekunde bereut.
@blaupause7
Ich konnte ihn auch erst jetzt sehen, weil er vorher leider nicht in meiner Gegend lief. Schön, dass er Dir auch gefallen hat.